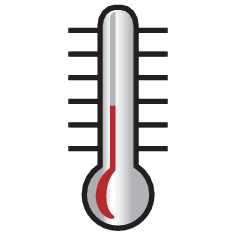Inhaltsverzeichnis
Hülsenfreiläufe
- Produktausführung
- Belastbarkeit
- Ausgleich von Winkelfehlern
- Schmierung
- Abdichtung
- Drehzahlen
- Geräusch
- Temperaturbereich
- Käfige
- Lagerluft
- Abmessungen, Toleranzen
- Nachsetzzeichen
- Aufbau der Produktbezeichnung
- Dimensionierung
- Gestaltung der Umgebungskonstruktion
- Ein- und Ausbau
- Rechtshinweis zur Datenaktualität
Hülsenfreiläufe
Hülsenfreiläufe:
- sind Einwegkupplungen, die hohe Drehmomente in einer Richtung übertragen ➤ Bild
- werden ohne und mit integrierter Lagerung angeboten ➤ Bild, ➤ Bild und ➤ Bild
- arbeiten sehr schaltgenau
- ermöglichen hohe Schaltfrequenzen
- haben ein geringes Leerlaufreibmoment
- sind befettet und unbefettet lieferbar
- sind radial besonders raumsparend und ermöglichen dadurch äußerst kompakte Konstruktionen
- eignen sich für Gehäusewerkstoffe aus Stahl, Leichtmetall oder Kunststoff
- sind kombinierbar mit Nadelhülsen HK und Nadelbüchsen BK
- sind sehr vielseitig einsetzbar, beispielsweise als Schrittschaltwerk, Rücklaufsperre oder Überholkupplung ➤ Bild.
|
Hülsenfreiläufe in einem Schaltsystem in Tandem-Anordnung
|
 |
Produktausführung
Ausführungsvarianten
Hülsenfreiläufe gibt es:
Hülsenfreiläufe
Hülsenfreiläufe sind Einwegkupplungen
Diese Hülsenfreiläufe bestehen aus dünnwandigen, spanlos geformten Außenhülsen mit Klemmrampen am Innendurchmesser, Kunststoffkäfigen und Nadelrollen, die als Klemmelemente dienen. Federn aus Stahl oder Kunststoff halten die Nadelrollen in der Klemmposition. Hülsenfreiläufe übertragen hohe Drehmomente in einer Richtung und sind radial besonders raumsparend. Die Freiläufe gibt es ohne und mit Stützlagerung.
Für Anwendungen mit hohen Schaltfrequenzen geeignet
Hülsenfreiläufe arbeiten sehr schaltgenau, da durch die Einzelanfederung der Nadelrollen der ständige Kontakt zwischen Welle, Nadelrollen und Klemmrampen gesichert ist. Sie erlauben hohe Schaltfrequenzen durch ihre geringe Masse und das damit verbundene niedrige Trägheitsmoment der Klemmelemente. Außerdem haben sie ein nur geringes Leerlaufreibmoment.
Bevorzugte Einsatzfelder
Die Hülsenfreiläufe können in vielen Anwendungen eingesetzt werden, beispielsweise als Schrittschaltwerk, Rücklaufsperre oder Überholkupplung. Hier übernimmt der Hülsenfreilauf dann die Überhol- oder Haltefunktion.
Hülsenfreiläufe dürfen nicht eingesetzt werden, wenn Personen bei Fehlfunktion gefährdet sind. Neue Anwendungen, besonders solche mit Extrembedingungen, sind durch Versuche abzusichern. Die Funktion ist nur dann gewährleistet, wenn der Konzentrizitätsfehler zwischen Stützlager und Welle gering gehalten wird.
Hülsenfreiläufe ohne Lagerung
Nur zur Aufnahme von Drehmomenten geeignet
Freiläufe HF haben keine Lagerung; d. h., sie übertragen nur Drehmomente und können deshalb auch keine Radialkräfte aufnehmen ➤ Bild. Die Konzentrizität zur Wellenachse muss bei diesen Freiläufen durch zusätzliche Wälzlager abgesichert oder es müssen Hülsenfreiläufe mit Lagerung verwendet werden. Die Hülsenfreiläufe werden ohne und mit Rändelung geliefert.
Hülsenfreiläufe ohne Rändelung
Hülsenfreiläufe ohne Rändelung gibt es mit Andruckfedern aus Stahl oder Kunststoff ➤ Bild. Lager mit Kunststofffedern haben das Nachsetzzeichen KF ➤ Abschnitt.
Hülsenfreiläufe mit Rändelung
Zur besseren Übertragung des Drehmoments in Kunststoffgehäusen können Hülsenfreiläufe mit einer Rändelung am Außenmantel geliefert werden. Diese Hülsenfreiläufe haben das Nachsetzzeichen R ➤ Abschnitt. Die Rändelung kann nur auf einen Teil der Hülse aufgebracht sein oder über deren ganze Länge gehen. Die Hülsenfreiläufe gibt es ebenfalls mit Andruckfedern aus Stahl oder Kunststoff. Freiläufe mit Kunststofffedern haben das Nachsetzzeichen KF ➤ Abschnitt.
|
Hülsenfreiläufe ohne Lagerung, ohne oder mit Rändelung
|
 |
Hülsenfreiläufe mit Lagerung
Auch zur Aufnahme radialer Kräfte geeignet
Freiläufe HFL nehmen aufgrund der integrierten Gleit- oder Wälzlager neben den Drehmomenten auch radiale Kräfte auf ➤ Bild und ➤ Bild. Die Hülsenfreiläufe werden ohne und mit Rändelung geliefert.
Hülsenfreiläufe ohne Rändelung
Hülsenfreiläufe ohne Rändelung gibt es mit Andruckfedern aus Stahl oder aus Kunststoff ➤ Bild und ➤ Bild. Hülsenfreiläufe mit Kunststofffedern haben das Nachsetzzeichen KF ➤ Abschnitt.
Hülsenfreiläufe mit Rändelung
Zur besseren Übertragung des Drehmoments in Kunststoffgehäusen können Hülsenfreiläufe mit einer Rändelung am Außenmantel geliefert werden. Diese Hülsenfreiläufe haben das Nachsetzzeichen R ➤ Abschnitt. Die Rändelung kann nur auf einen Teil der Hülse aufgebracht sein oder über deren ganze Länge gehen. Diese Hülsenfreiläufe gibt es ebenfalls mit Andruckfedern aus Stahl oder Kunststoff. Freiläufe mit Kunststofffedern haben das Nachsetzzeichen KF ➤ Abschnitt.
|
Hülsenfreiläufe mit Gleitlagerung, ohne oder mit Rändelung Fr = Radiale Belastung
|
 |
|
Hülsenfreilauf mit Wälzlagerung, ohne Rändelung Fr = Radiale Belastung
|
 |
Klemmrichtung des Hülsenfreilaufs
Ein Pfeil auf der Stirnseite der Hülse zeigt die Klemmrichtung des Hülsenfreilaufs an. Der Freilauf klemmt, wenn die Hülse in Pfeilrichtung gedreht wird.
Belastbarkeit
Freiläufe mit Stützlagerung nehmen radiale Kräfte auf
Abhängig von der Ausführung (ohne oder mit Lagerung) können Hülsenfreiläufe entweder nur Drehmomente oder zusätzlich auch radiale Belastungen übertragen ➤ Abschnitt, ➤ Bild und ➤ Bild. Bei Freiläufen ohne Lagerung müssen radiale Kräfte durch zusätzliche Lager abgestützt werden.
Übertragbares Drehmoment
Die Steifigkeit des Gehäuses bestimmt das übertragbare Drehmoment
Zum Übertragen des Drehmoments wird ein steifes Gehäuse vorausgesetzt. Somit hängt das übertragbare Drehmoment vom Gehäuse- und Wellenwerkstoff, von der Wellenhärte, von der Gehäusewanddicke und von den Gehäuse- und Wellentoleranzen ab. Bei der Berechnung des Drehmoments sind das maximale Antriebsmoment und Trägheitsmoment der beschleunigten Massen zu berücksichtigen.
Grenzbeanspruchung
Grenzbelastung nicht überschreiten
Bei Hülsenfreiläufen mit Gleitlagern darf im Betriebszustand das Produkt aus tatsächlicher Drehzahl n und Radiallast Fr den Wert der angegebenen Grenzbeanspruchung (Fr · n)max nicht überschreiten. Die angegebenen Grenzdrehzahlen in den Produkttabellen sowie die zulässige Radiallast bestimmen die Anwendungsgrenzen.
Schaltgenauigkeit und Schaltfrequenz
Der Freilauf darf nicht überlastet werden
Um den Freilauf nicht zu überlasten, muss die Trägheit des Gesamtsystems berücksichtigt werden. Die hohe Schaltgenauigkeit ergibt sich aus der Einzelanfederung der Nadelrollen, die den ständigen Kontakt zwischen Welle, Nadelrollen und Klemmfläche sicherstellt. Die Schaltgenauigkeit wird beeinflusst durch die Schaltfrequenz, Schmierung, Einbautoleranzen, Umgebungskonstruktion, elastische Verformung der Anschlussteile und den Antrieb durch die Welle oder das Gehäuse. Die beste Genauigkeit ergibt sich, wenn der Antrieb über die Welle erfolgt.
Hohe Schaltfrequenzen durch geringe Masse
Hohe Schaltfrequenzen resultieren aus der geringen Masse und dem damit verbundenen niedrigen Trägheitsmoment der Klemmelemente.
Reibmoment und Reibleistung
Zum Verlauf des Reibmoments ➤ Bild. Die Reibleistung im Leerlauf hängt davon ab, ob sich die Welle oder der Außenring dreht ➤ Bild.
|
Leerlauf-Reibmoment, abhängig vom Wellendurchmesser MR = Leerlauf-Reibmoment d = Wellendurchmesser |
 |
|
Reibleistung im Leerlauf, abhängig von der Drehzahl NR = Leerlauf-Reibleistung n = Drehzahl nGA = Grenzdrehzahl bei umlaufendem Außenring nGW = Grenzdrehzahl bei drehender Welle |
 |
Drehender Außenring
Durch die Fliehkraft können die Nadelrollen von der Welle abheben
Dreht sich der Außenring, nimmt die Reibleistung mit steigender Drehzahl zunächst zu, sie fällt aber durch die Fliehkraft der Nadeln allmählich gegen Null. Hier ist die Drehzahl erreicht, bei der zwischen den Nadelrollen und der Welle kein Reibschluss mehr vorhanden ist. Durch die weiter steigende Fliehkraft heben die Nadeln dann von der Welle ab.
Ausgleich von Winkelfehlern
Die Konzentrizität ist die grundsätzliche Voraussetzung für die Funktion des Freilaufs. Die Funktion ist nur dann gewährleistet, wenn der Konzentrizitätsfehler zwischen Stützlager und Welle gering gehalten wird.
Schmierung
Zur Erstbefettung wird ein Fett nach GA26 verwendet
Die Freiläufe sind mit einem Lithiumseifenfett nach GA26 befettet. Die Erstbefettung reicht in vielen Fällen für die Gebrauchsdauer der Lager. Für Anwendungen mit Ölschmierung sind unbefettete Freiläufe lieferbar. Diese Freiläufe sind konserviert. Für allgemeine Anwendungen (Mischbetrieb von Klemmen und Überholen) hat sich die Schaeffler-Erstbefettung bewährt. Zur optimalen Funktion kann es erforderlich sein, unterschiedliche Schmierstoffe zu verwenden. Die Eignung des Schmierstoffs ist dann durch Versuche abzusichern.
Für Anwendungen, bei denen ein Betriebszustand (Überholen oder Klemmen) stark überwiegt, sollte auf eine Sonderbefettung zurückgegriffen werden. In diesem Fall bitte bei Schaeffler rückfragen.
Eine Fettgebrauchsdauer kann nicht berechnet werden
Für Hülsenfreiläufe ist keine Berechnung der Fettgebrauchsdauer oder der Schmierfrist möglich. Wird nachgeschmiert, ist mit Öl zu schmieren, oder es sollte generell auf Ölschmierung umgestellt werden. Bei Temperaturen < –10 °C und Drehzahlen > 0,7 nG sind Schmierstoffempfehlungen anzufordern. Bei Temperaturen über +70 °C ist mit Öl zu schmieren. Der Ölstand ist so zu wählen, dass der Hülsenfreilauf bei Stillstand und waagerechter Achse ungefähr 1/3 in das Ölbad eintaucht.
Einsetzbare Schmieröle
Geeignete Schmieröle sind CL und CLP nach DIN 51517 oder HL und HLP nach DIN 51524. Viskositätsklassen ➤ Tabelle.
Verträglichkeit mit Kunststoffkäfigen
Werden Lager mit Kunststoffkäfig verwendet, ist sicherzustellen, dass beim Einsatz von Syntheseölen oder Schmierfetten auf Syntheseölbasis sowie bei Schmierstoffen mit einem hohen Anteil an EP‑Zusätzen die Verträglichkeit des Schmierstoffs mit dem Käfigmaterial gegeben ist.
Viskositätsklassen
|
Betriebstemperatur |
Viskositätsklasse |
|
|---|---|---|
|
°C |
||
|
von |
bis |
|
|
+15 |
+30 |
ISO VG 10 |
|
+15 |
+90 |
ISO VG 32 |
|
+60 |
+120 |
ISO VG 100 |
Abdichtung
Hülsenfreiläufe (mit und ohne Lagerung) werden ohne Abdichtung geliefert. Verunreinigungen (Staub, Schmutz und Feuchtigkeit) beeinflussen die Funktion und Gebrauchsdauer der Freiläufe nachteilig.
Abdichtung der Lagerstelle mit Dichtringen G oder SD
Wirkungsvolle Dichtelemente zur Abdichtung offener Hülsenfreiläufe bei Verschmutzungsgefahr
Bei Verschmutzungsgefahr sind Dichtringe der kostengünstigen Baureihen G oder SD einzubauen ➤ Link. Die Dichtringe sind als berührende Dichtungen ausgeführt und werden vor dem Freilauf angeordnet. Sie schützen die Lagerstelle sicher vor Verunreinigungen, Spritzwasser und übermäßigem Verlust von Schmierfett. Die Dichtringe sind auf die geringen radialen Abmessungen der Hülsenfreiläufe abgestimmt und mit breiteren Innenringen der Baureihe IR kombinierbar. Sie sind sehr montagefreundlich, da sie einfach in die Gehäusebohrung gepresst werden.
Drehzahlen
Drehzahlen für drehende Welle oder umlaufenden Außenring
Die Grenzdrehzahlen nGW und nGA in den Produkttabellen gelten für Öl- und Fettschmierung. Die Grenzdrehzahl nGW gilt bei drehender Welle, nGA bei umlaufendem Außenring.
Geräusch
Schaeffler Geräuschindex
Der Schaeffler Geräuschindex (SGI) ist für diese Lagerart noch nicht verfügbar ➤ Link. Die Einführung und Aktualisierung der Daten für diese Baureihen erfolgt sukzessiv.
Temperaturbereich
Mögliche Betriebstemperaturen der Hülsenfreiläufe ➤ Tabelle.
Zulässige Temperaturbereiche
|
Betriebstemperatur |
Hülsenfreiläufe |
|---|---|
|
|
–10 °C bis +70 °C, begrenzt durch den Schmierstoff |
Sind Temperaturen zu erwarten, die außerhalb der angegebenen Werte liegen, bitte bei Schaeffler rückfragen.
Käfige
Zur Führung der Wälzkörper werden sowohl für den Freilauf als auch für integrierte, wälzgelagerte Stützlagerungen Kunststoffkäfige eingesetzt.
Lagerluft
Anstelle der Radialluft gilt der Hüllkreisdurchmesser Fw
Für Lager ohne Innenring ist anstelle der radialen Lagerluft das Maß des Hüllkreisdurchmessers Fw maßgebend. Der Hüllkreis ist der innere Begrenzungskreis der Nadelrollen bei spielfreier Anlage an der Außenlaufbahn. Bei Hülsenfreiläufen mit Wälzlagerung liegt der Hüllkreisdurchmesser Fw der Lager im eingebauten Zustand (im massivem Lehrring) etwa in der Toleranzklasse F8. Obere und untere Abmaße des Hüllkreisdurchmessers für die Toleranzklasse F8 ➤ Tabelle.
Abmaße des Hüllkreisdurchmessers der wälzgelagerten Hülsenfreiläufe
|
Hüllkreisdurchmesser Fw |
Toleranzklasse F8 |
||
|---|---|---|---|
|
mm |
Toleranz des Hüllkreisdurchmessers Fw |
||
|
oberes Abmaß |
unteres Abmaß |
||
|
über |
bis |
μm |
μm |
|
3 |
6 |
+28 |
+10 |
|
6 |
10 |
+35 |
+13 |
|
10 |
18 |
+43 |
+16 |
|
18 |
30 |
+53 |
+20 |
|
30 |
50 |
+64 |
+25 |
Abmessungen, Toleranzen
Abmessungen und Toleranzen der Hülsenfreiläufe sind nicht genormt. Die dünnwandigen Außenhülsen passen sich der Maß- und Formgenauigkeit der Gehäusebohrung an.
Nachsetzzeichen
Die Bedeutung der in diesem Kapitel verwendeten Nachsetzzeichen zeigt ➤ Tabelle sowie medias interchange http://www.schaeffler.de/std/1B69.
Nachsetzzeichen und ihre Bedeutung
|
Nachsetzzeichen |
Bedeutung der Nachsetzzeichen |
|
|---|---|---|
|
‒ |
Stahlfeder |
Standard |
|
KF |
Andruckfedern aus Kunststoff |
Standard |
|
R |
Außenmantel gerändelt |
Standard |
|
RR |
Hülsenfreilauf Corrotect-beschichtet |
Sonderausführung, |
Aufbau der Produktbezeichnung
Beispiele zur Bildung der Produktbezeichnung
Die Bezeichnung der Hülsenfreiläufe folgt einem festgelegten Schema. Beispiele ➤ Bild und ➤ Bild.
|
Hülsenfreilauf ohne Lagerung, ohne Rändelung: Aufbau des Kurzzeichens |
 |
|
Hülsenfreilauf mit Lagerung, Andruckfedern aus Kunststoff, mit Rändelung: Aufbau des Kurzzeichens |
 |
Dimensionierung
Die Größe wird anhand der Tragfähigkeit des Hülsenfreilaufs im Verhältnis zu den Belastungen und den Anforderungen an die Lebensdauer und Betriebssicherheit bestimmt ➤ Abschnitt.
Gestaltung der Umgebungskonstruktion
Ausführung der Gehäusebohrung
Außenhülse auf ganzem Umfang und ganzer Breite abstützen
Als Gehäusewerkstoff eignen sich Stahl, Leichtmetall oder Kunststoff. Damit die Leistungsfähigkeit der Hülsenfreiläufe voll genutzt werden kann und die geforderte Lebensdauer erreicht wird, müssen die Außenhülsen im Gehäuse ausreichend starr unterstützt werden. Die Abstützung für die Außenhülse in der Gehäusebohrung ist als zylindrische Sitzfläche auszuführen. Die Sitzflächen für die Außenhülse und die Laufbahn für die Wälzkörper bzw. den Innenring (wenn die Lagerung nicht als Direktlagerung ausgeführt ist) sollen nicht durch Nuten, Bohrungen oder sonstige Ausnehmungen unterbrochen sein. Die Genauigkeit der Gegenstücke muss bestimmten Anforderungen entsprechen, die Bohrungstoleranzen für die Gehäusebohrung (empfohlene Toleranzklassen) hängen vom Gehäusewerkstoff ab ➤ Tabelle und ➤ Tabelle. Die Oberflächengüte der Gehäusebohrung soll Ramax 0,8 betragen. Die Zylinderformtoleranz der Gehäusebohrung in Metallgehäusen sollte innerhalb der Toleranzqualität IT5/2 liegen.
Durch den dünnwandigen Mantel erhalten die Freiläufe ihre genaue Form erst in einer festen Passung. Die Genauigkeit der Aufnahmebohrung bestimmt deshalb im Wesentlichen die Formgenauigkeit der Hülse und damit die Funktion des Freilaufs.
Schlupffase an der Gehäusebohrung vorsehen
Zur beschädigungsfreien Montage der Hülsenfreiläufe muss die Gehäusebohrung eine Schlupffase von 15° haben.
Ausführung der Gehäusebohrung
|
Baureihe |
Feder |
Bohrung |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Gehäusewerkstoff |
|||||
|
Stahl Gusseisen |
Leichtmetall |
max. Bohrung |
|||
|
HF, HFL |
Stahl |
N6 Ⓔ (N7 Ⓔ)1) |
R6 Ⓔ (R7 Ⓔ)1) |
‒ |
|
|
HF..-KF, HFL..-KF |
Kunststoff |
N7 Ⓔ |
R7 Ⓔ |
‒ |
|
|
HF..-R, HFL..-R |
Stahl |
‒ |
‒ |
D |
0 –0,05 |
|
HF..-KF-R, HFL..-KF-R |
Kunststoff |
‒ |
‒ |
D |
0 –0,05 |
|
HFL0606-KF-R, HFL0806-KF-R |
Kunststoff |
‒ |
‒ |
D |
0 –0,05 |
- Die Klammerwerte sind anwendbar, wenn das zulässige Drehmoment Md per nach Produkttabelle nur bis zu 50% genutzt wird.
- Richtwerte, abhängig vom verwendeten Kunststoff. Außendurchmesser D.
Mindestwanddicke für Metallgehäuse
Maximal zulässiges übertragbares Drehmoment
Für Metallgehäuse wird das maximal zulässig übertragbare Moment Md per max in Abhängigkeit vom Durchmesserverhältnis QA nach ➤ Bild (Stahlgehäuse) oder nach ➤ Bild (Aluminiumgehäuse) bestimmt, siehe Berechnungsbeispiele.
Richtwerte für QA max bei Gehäusewerkstoff aus Stahl und Aluminium ➤ Tabelle.
Richtwerte
|
Gehäusewerkstoff |
Durchmesserverhältnis QA max |
|---|---|
|
Stahl |
0,8 |
|
Aluminium |
0,6 |
Die Vergleichsspannung σv darf die Streckgrenze des Gehäusewerkstoffs nicht überschreiten.
Stahlgehäuse
Berechnungsbeispiel
Für die Hülsenfreiläufe HF0612 soll das maximal zulässige übertragbare Drehmoment Md per max ermittelt werden ➤ Bild:
| Hülsenfreilauf | HF0612 |
| Gehäuse | Stahl |
| Toleranz der Gehäusebohrung | N6 Ⓔ ➤ Tabelle |
| Zulässige Gehäusespannung (Rp0,2) σv | 450 N/mm2 |
| Durchmesserverhältnis QA des Gehäuses | 0,9 |
| Zulässiges Drehmoment Md per | nach Produkttabelle |
Berechnung
| Md per max | = 60% Md per = 0,6 * 1,76 Nm = 1,056 Nm |
|
Stahlgehäuse Elastizitätsmodul QA = Durchmesserverhältnis Gehäuse DAi = Gehäusebohrung DAa = Gehäuseaußen-durchmesser Md per = Zulässiges Drehmoment Md per max = Maximal zulässiges übertragbares Drehmoment σv = Vergleichsspannung |
 |
Aluminiumgehäuse
Berechnungsbeispiel
Für den Hülsenfreilauf HF1616 soll das Durchmesserverhältnis QA des Gehäuses ermittelt werden ➤ Bild:
| Hülsenfreilauf | HF1616 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Toleranz der Gehäusebohrung | R6 Ⓔ ➤ Tabelle |
| Zulässige Gehäusespannung (Rp0,2) σv | 250 N/mm2 |
| Maximal zulässiges übertragbares Drehmoment Md per max |
10 Nm |
| Zulässiges Drehmoment Md per | nach Produkttabelle |
| daraus folgt Md per max/Md per | 50% |
Berechnung
| QA | = DAi /DAa ≤ 0,7 |
| DAa | ≥ DAi /0,7 = 22 mm /0,7 = 31,5 mm |
|
Aluminiumgehäuse Elastizitätsmodul QA = Durchmesserverhältnis Gehäuse DAi = Gehäusebohrung DAa = Gehäuseaußen-durchmesser Md per = Zulässiges Drehmoment Md per max = Maximal zulässiges übertragbares Drehmoment σv = Vergleichsspannung |
 |
Mindestwanddicke für Kunststoffgehäuse
Für Kunststoffgehäuse sind Hülsenfreiläufe mit teilweise oder durchgehend gerändeltem Außenmantel zu verwenden (Nachsetzzeichen R).
Der Richtwert für die Mindestwanddicke bei Kunststoffgehäusen ist:

Legende
| smin | mm |
Mindestwanddicke |
| D | mm |
Außendurchmesser des Freilaufs |
| Fw | mm |
Hüllkreis |
Axiale Sicherung
Eine feste Passung genügt im Allgemeinen zur axialen Festlegung
Hülsenfreiläufe sind sehr montagefreundlich und lassen einfache Anschlusskonstruktionen zu. Die Hülsenfreiläufe werden nur in die Gehäusebohrung gepresst und benötigen keine weitere axiale Fixierung. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Vorgaben nach ➤ Tabelle eingehalten werden.
Gestaltung der Welle/Laufbahn
Laufbahn als Wälzlagerlaufbahn ausführen
Hülsenfreiläufe HF/HFL werden meist ohne Innenring eingesetzt. Um die Funktion der Hülsenfreiläufe zu gewährleisten, muss die Laufbahn für die Wälzkörper auf der Welle als Wälzlagerlaufbahn ausgeführt (gehärtet und geschliffen) sein. Die Oberflächenhärte der Laufbahnen muss 670 HV bis 840 HV betragen, die Einhärtungstiefe CHD ausreichend tief sein (CHD ≧ 0,3 mm). Gestaltung der Laufbahnen ➤ Tabelle. Ist die Welle nicht als Laufbahn ausführbar, können die Lager mit den Innenringen IR oder LR kombiniert werden.
Schlupffase an der Welle vorsehen
Zur beschädigungsfreien Montage der Lager muss die Welle eine Schlupffase von 10° bis 15° bei einer Breite von ca. 1 mm haben.
Ausführung der Welle
|
Baureihe |
Feder |
Welle |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Toleranzklasse1) |
Rundheittoleranz |
Parallelitätstoleranz |
empfohlener |
||
|
Ramax (Rzmax) |
|||||
|
max. |
max. |
μm |
|||
|
HF, HFL |
Stahl |
h5 (h6)2) |
IT3 |
IT3 |
0,4 (2) |
|
HF..-KF, HFL..-KF |
Kunststoff |
h8 |
|||
|
HF..-R, HFL..-R |
Stahl |
h5 (h6)2) |
|||
|
HF..-KF-R, HFL..-KF-R |
Kunststoff |
h8 |
|||
|
HFL0606-KF-R , |
Kunststoff |
h9 |
|||
- Es gilt die Hüllbedingung Ⓔ.
- Die Klammerwerte sind anwendbar, wenn das zulässige Drehmoment Md per nur bis zu 50% genutzt wird.
Ein- und Ausbau
Hülsenfreiläufe vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit schützen; Verunreinigungen beeinflussen die Funktion und Gebrauchsdauer der Freiläufe nachteilig. Einpresskräfte niemals über die Wälzkörper leiten. Die Hülsenfreiläufe dürfen beim Einpressen nicht verkantet werden, da dies zu Beschädigungen an den Nadelrollen und Laufbahnen führen kann.
Transportsicherung
Hülsenfreiläufe werden normalerweise bei kleinen Stückzahlen einzeln verpackt. Bei der Abnahme größerer Stückzahlen werden die Freiläufe lagerichtig auf Blister gesteckt und so geliefert. Die Blister dienen dann gleichzeitig als Transportsicherung.
Entnahme der Hülsenfreiläufe aus der Verpackung
Hülsenfreiläufe erst unmittelbar vor der Montage aus der Originalverpackung entnehmen. Werden Freiläufe aus einer Sammelverpackung mit Trockenkonservierung entnommen, Verpackung anschließend sofort wieder verschließen. Die schützende Dampfphase bleibt nur in der geschlossenen Verpackung erhalten. Unbefettete Hülsenfreiläufe sind konserviert. Die Ölschmierung muss nach dem Einpressen entsprechend den Vorgaben erfolgen.
Aufbewahrung
Hülsenfreiläufe aufbewahren:
- in trockenen, sauberen Räumen mit möglichst konstanter Raumtemperatur
- bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 65%.
Lagerfähigkeit
Die Lagerfähigkeit befetteter Hülsenfreiläufe ist durch die Haltbarkeit des Schmierfetts begrenzt.
Einbau mit Einpressdorn
Hülsenfreiläufe sind ausschließlich mit einem speziellen Montagedorn in die Aufnahmebohrung zu pressen. Dabei ist auf die Klemmrichtung des Freilaufs zu achten. Die Klemmrichtung ist auf der Stirnseite der Hülse durch einen Pfeil gekennzeichnet.
Der Hülsenfreilauf klemmt, wenn die Hülse in Pfeilrichtung gedreht wird.
Funktionsprüfung
Freiläufe ohne Rändelung
Die Funktion dieser Freiläufe wird in einem Gehäuse mit der nach ➤ Bild ermittelten Mindestwanddicke – oder stärker – geprüft. Dazu müssen die Gehäusebohrungs- und Wellentoleranzen eingehalten werden ➤ Tabelle und ➤ Tabelle.
Freiläufe mit Rändelung
Die Funktion dieser Freiläufe wird im nichteingepressten Zustand geprüft. Prüfkriterien sind hier Klemmwirkung und Leerlauf.
Bestehen Fragen zum Einbau der Hülsenfreiläufe, bitte bei Schaeffler rückfragen.
Schaeffler-Montagehandbuch
Hülsenfreiläufe sehr sorgfältig behandeln
Damit die Hülsenfreiläufe ihre Funktion einwandfrei erfüllen und die vorgesehene Gebrauchsdauer ohne Beeinträchtigung erreichen, müssen sie sorgfältig behandelt werden.
Das Schaeffler-Montagehandbuch MH 1 informiert umfassend über die sachgemäße Lagerung, Montage, Demontage und Wartung rotatorischer Wälzlager http://www.schaeffler.de/std/1B68. Daneben enthält es Angaben, die der Konstrukteur für den Ein‑ und Ausbau und die Wartung der Lager schon bei der Gestaltung der Lagerstelle beachten muss. Das Buch liefert Schaeffler auf Anfrage.
Rechtshinweis zur Datenaktualität
Die Weiterentwicklung der Produkte kann auch zu technischen Änderungen an Katalogprodukten führen
Im Mittelpunkt des Interesses von Schaeffler stehen die Optimierung und die Weiterentwicklung seiner Produkte und die Zufriedenheit seiner Kunden. Damit Sie sich als Kunde bestmöglich über diesen Fortschritt und den aktuellen technischen Stand der Produkte informieren können, veröffentlichen wir Produktänderungen gegenüber der gedruckten Ausgabe in unserem elektronischen Produktkatalog.
Änderungen der Angaben und Darstellungen dieses Katalogs behalten wir uns daher vor. Dieser Katalog gibt den Stand bei Drucklegung wieder. Neuere Veröffentlichungen unsererseits (in Printmedien oder digital) gehen automatisch diesem Katalog vor, soweit sie dasselbe Thema betreffen. Bitte prüfen Sie daher stets über unseren elektronischen Produktkatalog, ob aktuellere Informationen oder Änderungshinweise für Ihr gewünschtes Produkt verfügbar sind.